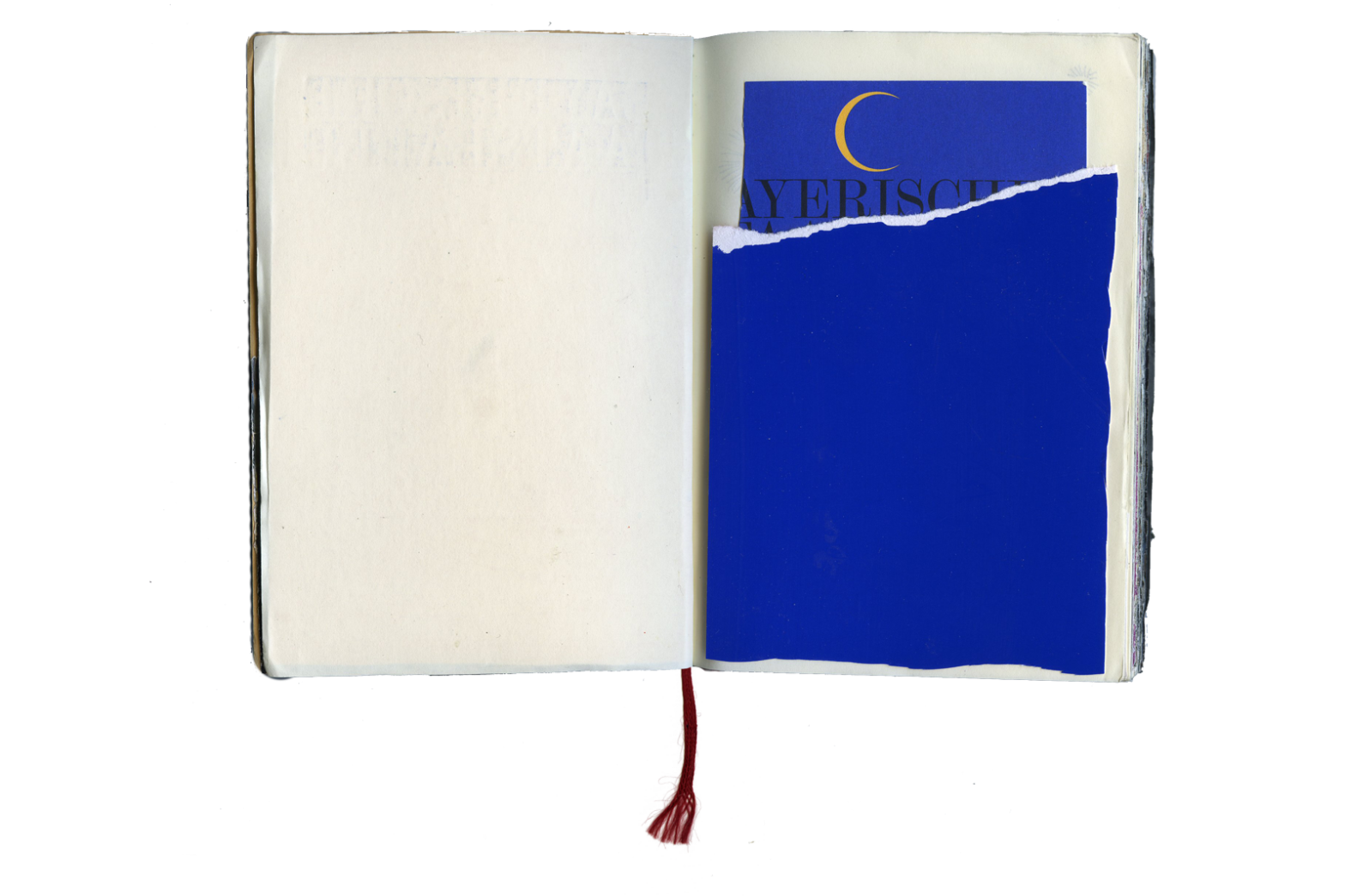Von meinem Kinderzimmer aus konnte ich in eine Dachrinne und darüber Tannenwipfel, Felder und den Himmel sehen. Wenn ich in den Himmel sah, musste ich an Amerika denken, ein Land, das ist nicht kannte, aber das für mich Symbol von etwas Großem, Fernen, Mächtigen war, für etwas Heiteres und Optimistisches, ein Land, in dem man alles in den Griff bekam. Ich weiß nicht, woher ich diese Gefühle und Projektionen bezog, denn meine Eltern machten sich lustig über Amerika, sie bekamen böse Gesichter, wenn es um etwas Amerikanisches ging, amerikanisch war ein Schimpfwort.
Jedenfalls, wenn ich Angst bekam, und ich hatte ununterbrochen Angst vor beinahe allem, dann sah ich in dieses Stück Himmel und stellte mir vor, dass es einen amerikanischen Präsidenten gab, der alles regeln konnte.
Das Problem aber war, dass es jeden Abend Nacht wurde, und nachts half gegen meine Angst nicht einmal mehr der Glaube an den amerikanischen Präsidenten, im Gegenteil, nachts begann ich zu ahnen, dass auch der amerikanische Präsident nur ein kleiner Junge im Körper eines alten Mannes war und dass auch ihm am Ende niemand würde helfen können.
Immerhin, sagte ich mir damals: Wenn man den Mond am Nachthimmel sieht, bedeutet das, dass man auf der anderen Seite der Erdkugel anrufen kann und dort ist Tag. Am Tag hatte ich weniger Angst als in der Nacht, alles war ausgeleuchtet und niemand schlief.
Und obwohl ich wusste, dass es nur einen Erdmond für alle gab, kam er mir jede Nacht wie mein persönlicher Mond vor; die anderen hatten sicher auch einen, aber dieser Mond war wirklich nur mein Mond. Immer war er da, immer musste er mir beistehen, der Arme, und immer habe ich gehofft, dass er es kann, ich Arme.
Bis heute muss ich jeden Abend aus dem Fenster sehen und vor dem Schlafengehen das gesichtloses Gesicht des Mondes suchen, damit es mir sagt, was es mir immer sagt, nämlich nichts und damit alles.